Saarbrücken, den 26.November 2025. Ein Austausch mit dem CoopBund, der Freien Universität Bozen und Praxisakteuren zeigte: Südtirol verbindet konsequente Förderprüfung mit digitaler Verwaltung – und schafft so mehr Tempo für Bürger-, Dienstleistungs- und Energiegenossenschaften.
Bereits in der Kalenderwoche 45 reiste eine Delegation aus Deutschland nach Südtirol, um sich mit Expertinnen und Experten zu Revision/Förderprüfung, Digitalisierung genossenschaftlicher Prozesse und Energy Sharing auszutauschen. Stationen waren unter anderem:
- die Freie Universität Bozen (Gespräch mit Prof. Susanne Elsen und Kolleg:innen),
- ein Fachseminar mit dem Genossenschaftsrechtler und -praktiker Oscar Kiesswetter,
- sowie Arbeitsgespräche beim CoopBund Alto Adige–Südtirol.
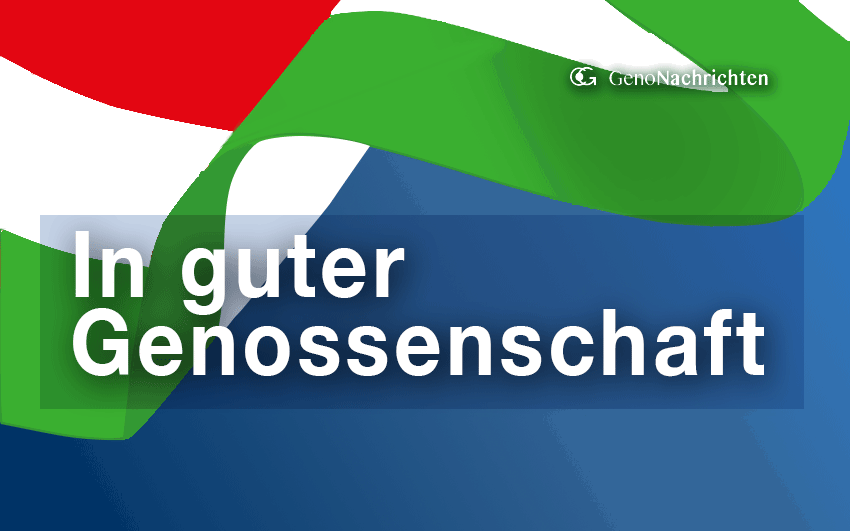
Praxisnah wurde es beim Besuch der Energiegenossenschaft Ötzi, die aktuell die Umsetzung von Energy Sharing vorbereitet. Höhepunkt der Reise: CoopBund , CoopGo Saarbrücken und die GenoFabrik bekräftigten die Absicht, enger zusammenzuarbeiten – von EU-Förderprojekten über Studentengenossenschaften bis hin zu Workers-Buy-outs und Energiegenossenschaften.
Der Blick nach Südtirol macht deutlich: Wo Förderprüfung tatsächlich als „Förderungsprüfung“ verstanden wird und Digitalisierung konsequent auf Mitglieder-Nutzen ausgerichtet ist, entstehen Spielräume, die in Deutschland bislang durch Rechtsunsicherheit, prüfungsrechtliche Engpässe und fragmentierte Verwaltungsprozesse blockiert werden. Dies sind wichtige Impulse das Deutschland für die Novellierung des Genossenschaftsgesetzes berücksichtigen kann.
Uni Bozen: Förderlogik zuerst – und die Region im Blick
An der Freien Universität Bozen stand eine scheinbar einfache, tatsächlich aber grundlegende Frage im Mittelpunkt: Wie bleibt die Genossenschaft ihrem Förderzweck treu, wenn sie wächst, digitalisiert – und neue Geschäftsfelder betritt?
Die Forschungsarbeiten und Lehrprojekte in Bozen betonen drei Punkte, die für die deutsche Debatte bemerkenswert sind:
- Mitgliederzentrierung statt Abstraktion
Förderung wird nicht abstrakt als „Gemeinwohl“ oder „Region“ definiert, sondern als konkreter Nutzen für Mitglieder gemessen: Preis-/Leistungsvorteile, bessere Nutzungsbedingungen, Servicequalität und Verfügbarkeit – jeweils verankert in der Region. Damit wird der Förderzweck im Sinne des Genossenschaftsgesetzes als reale, messbare Mitgliederförderung verstanden, nicht als bloßer Imagebegriff. - Offene Kooperationen als Strukturprinzip
Bozen und Brixen arbeiten eng mit Gemeinden, Hochschulen, Sozialpartnern und Start-ups zusammen. Bürger:innen- und Infrastrukturgenossenschaften werden bewusst als Teil der lokalen Daseinsvorsorge verstanden – von Dorfläden über Pflege- und Kulturangebote bis hin zu Energieprojekten. Forschung und Praxis sind hier kein „Transferprojekt“, sondern ein gemeinsamer Lernraum. - Genossenschaften als Träger sozialer Innovation
Genossenschaften werden nicht nur als „Unternehmen mit Sonderrechtsform“ betrachtet, sondern als Organisationsform für ökosoziale Transformation: Wohnen, Pflege, Kreislaufwirtschaft, Gemeinwesenarbeit und Bürger:innenenergie werden explizit zusammengedacht.
Die Lehre daraus für deutsche Genossenschaften: Digitalisierung ist Mittel, nicht Zweck. Zuerst steht der Fördernutzen – dann kommen Tools, Plattformen und Workflows. Ohne klare Förderlogik wird jede „digitale Genossenschaft“ zur verkappten Kapitalgesellschaft mit Mitgliederstimme.
Seminar mit Oscar Kiesswetter: Was das italienische und das Südtiroler Modell unterscheidet
Im Fachseminar mit Oscar Kiesswetter wurden rechtliche und organisatorische Besonderheiten des italienischen Genossenschaftsmodells vertieft – mit direkter Relevanz für die aktuelle GenG-Debatte in Deutschland:
- Revision als echte Förderprüfung
Die gesetzliche Prüfung betrachtet Wirtschaftlichkeit und Mitgliederförderung gemeinsam. Der Prüfungsauftrag ist nicht auf Bilanzkontrolle reduziert, sondern fragt:- Werden Mitglieder im Kerngeschäft tatsächlich besser gestellt als Außenstehende?
- Sind Geschäftsmodelle und Investitionen mit dem Förderzweck vereinbar?
- Werden Gewinne so verwendet, dass Fördererfolg und Stabilität zusammenpassen?
Damit wird das, was die deutsche Diskussion um Pflichtprüfung oft nur theoretisch fordert – eine „förderwirtschaftliche Erfolgskontrolle“ – praktisch umgesetzt.
- Arbeitnehmer- und Dienstleistungsgenossenschaften / Workers-Buy-outs
In Italien sind Workers-Buy-outs (WBO) kein exotisches Randphänomen, sondern etablierte Krisenlösung: Beschäftigte übernehmen Unternehmen oder Unternehmensteile in genossenschaftlicher Mit-Eigentümerschaft, wenn Betriebe wanken.
Das Ergebnis: Know-how bleibt vor Ort, regionale Wertschöpfung wird gesichert, und Belegschaften gewinnen unternehmerische Mitsprache. Das Marcora-Gesetz und nachfolgende Regelungen schaffen dafür einen rechtlich wie finanziell abgesicherten Rahmen. - Energiegenossenschaften und CER-Rahmen (Comunità Energetiche Rinnovabili)
Der italienische Rechtsrahmen für Energiegemeinschaften und Energy Sharing (Art. 22 RED II, nationale CER-Regelungen) wird pragmatisch angewendet:- vereinfachte Bilanzierungsregeln,
- klar definierte Trägerstrukturen,
- nachvollziehbare Netzentgelt-Logiken,
- sowie Förderinstrumente, die explizit auf Bürger:innenbeteiligung zielen.
Die Quintessenz aus Südtiroler Sicht: Prüfen, was wirkt – und Hürden dort abbauen, wo sie keinen zusätzlichen Schutz, aber viel Verzögerung erzeugen. Für Deutschland heißt das: Pflichtprüfung und Aufsicht müssen sich konsequent am Förderzweck der Genossenschaft (§ 1 GenG) orientieren – nicht an einem abstrakten, rein formalen „Compliance-Check“.
Treffen beim CoopBund: Zusammenarbeit von Bildung bis EU-Förderung
Beim CoopBund wurden konkrete Kooperationspfade zwischen Südtirol und Deutschland diskutiert:
- EU-Projekte
Gemeinsame Anträge sollen Programme adressieren, die Bürgerenergie, soziale Dienste, digitale Genossenschaften und ländliche Daseinsvorsorge zusammen denken – also genau jene Bereiche, in denen Bürger:innen- und Sozialgenossenschaften in Italien und Ostdeutschland bereits heute Versorgungslücken schließen. - Bildung & Studentengenossenschaften
Geplant ist der Aufbau von Studierenden-eG als Lern- und Gründungslabore:- angewandte Lehre im genossenschaftlichen Rechnungswesen, Governance und Förderlogik,
- reale Projekte mit Kommunen und Mittelstand,
- Verknüpfung mit Themen wie Energy Communities, Sharing-Plattformen und Caring-Communities.
- Dienstleistungs- und Bürgergenossenschaften
Die Delegation diskutierte Modelle zur Professionalisierung von Geschäftsmodellen in Pflege, Nahversorgung, Mobilität, Kultur und Infrastruktur – mit dem Ziel, bürgerschaftliches Engagement und wirtschaftliche Tragfähigkeit dauerhaft zu verbinden. - Workers-Buy-outs und Unternehmensnachfolge
Südtirol und Italien bieten Erfahrungen, wie Belegschaften Betriebe in die eigene Hand nehmen – gestützt durch Fonds, Beratung und Prüfungsverbände. Für die deutsche Debatte um Nachfolge in Mittelstandsbetrieben ist das eine kaum genutzte Option.
Der gemeinsame Nenner: Mitglieder stärken, regionale Wertschöpfung binden, Zeitpläne beschleunigen – ohne den Förderzweck zugunsten kurzfristiger Renditeziele zu opfern.
Energy Sharing in der Praxis: Ötzi zeigt, was möglich ist
Die Gespräche mit der Energiegenossenschaft Ötzi machten sichtbar, wie Energy Sharing im Alltag aussehen kann, wenn Rechts- und Umsetzungsrahmen zusammenspielen:
- Technik und Systemintegration
PV-Dächer, Speicher, Wärmenetze und perspektivisch Elektrolyse werden quartiersweise koordiniert. Stromflüsse werden lokal optimiert, Abwärme genutzt, Lasten intelligent gesteuert. Das Ziel ist klar: maximale Eigen- und Direktnutzung, minimale Netzbelastung. - Ökonomische Wirkung
Für Unternehmen im Gewerbegebiet bedeutet das: planbare, sinkende Energiekosten, eine höhere Resilienz gegenüber Preisschocks und eine Verbesserung der Standortqualität. Für Bürgerinnen und Bürger: Mitmachen statt nur bezahlen – in Form von Mitgliedschaft, Mitsprache und Beteiligung an den Vorteilen. - Regulatorische Voraussetzung
Möglich wird dies, weil Energy Sharing nicht als „Sonderfall einer klassischen Lieferbeziehung“, sondern als eigene Logik gedacht wird: Die Energiegemeinschaft ist Trägerin, die Mitglieder sind zugleich Prosumer, und die Netzentgelte spiegeln die tatsächlich beanspruchten Infrastrukturen wider.
Für Deutschland, wo Energy Sharing bislang vor allem durch Komplexität der Abrechnung, Netzentgeltsystematik und unklare Zuordnung von Rollen gebremst wird, ist Ötzi ein praktisches Argument für einen eigenständigen, genossenschaftsfreundlichen Rechtsrahmen für Energiegemeinschaften.
Digitalisierung: Vom digitalen Beitritt bis zur digitalen Förderprüfung
Ein roter Faden der Reise war die konsequente Digitalisierung entlang des gesamten Genossenschaftslebenszyklus – allerdings mit einer klaren Leitfrage: „Wie verbessert das die Mitgliederförderung?“
- Digitale Genossenschaftsverwaltung (GenoFabrik)
Von der Mitgliedsaufnahme (Textform/eID) über Satzungs- und Organprozesse bis zum Reporting werden Abläufe verschlankt und revisionssicher dokumentiert. Das reduziert Kosten, schafft Transparenz und ermöglicht kleinen wie großen Genossenschaften, professionelle Prozesse ohne Overhead zu etablieren. - Digitaler Auditprozess als Förderprüfung
Die Pflichtprüfung wird datenbasiert gedacht: Standardisierte Wirkungs-Module bilden ab,- welche Naturalförderung je Euro Mitgliederumsatz erfolgt,
- wie Servicelevel und Erreichbarkeit gestaltet sind,
- welche regionalen Effekte (Arbeitsplätze, regionale Wertschöpfung, Daseinsvorsorge) entstehen.
Damit wird die vom Gesetz geforderte Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung mit einer echten Fördererfolgskontrolle verknüpft – ein Ansatz, der in der deutschen Fachliteratur zur Pflichtprüfung inzwischen ausdrücklich diskutiert wird.
- Schnittstellen zu Kommunen und Hochschulen
Über gemeinsame Datenräume können Kommunen, Hochschulen und Genossenschaften kontinuierlich sehen:- Was kommt bei Bürger:innen und Mitgliedern an?
- Wo hakt es in der Umsetzung?
- Welche Modelle skalieren, welche nicht?
Die Kernidee lässt sich auf eine Formel bringen: weniger Papier, mehr Wirkung – und Mitglieder sehen in Echtzeit, was ihre Genossenschaft leistet und ob sie ihrem Förderauftrag gerecht wird.
Ausblick: Gemeinsames Genossenschaftsseminar 2026 in Südtirol
Für das Jahr 2026 ist eine mehrtägige Studienreise nach Südtirol geplant. Derzeit laufen Vorgespräche mit dem zuständigen Volkshochschulverband Saarbrücken.
Die Delegation prüft, 2026 ein gemeinsames Genossenschaftsseminar in Südtirol auszurichten – mit Praxisformaten zu Energie-, Dienstleistungs-, Bürger- und Studentengenossenschaften, flankiert von Workshops zu:
- Revision/Förderprüfung und Pflichtprüfung als Betreuungsprüfung,
- Digitalisierung und KI-gestützten Back-Office-Prozessen,
- Energy Sharing und Energiegemeinschaften,
- Workers-Buy-outs und Unternehmensnachfolge in genossenschaftlicher Trägerschaft.
Ziel ist es, deutsch-italienische Lernschleifen zu etablieren und Best Practices so aufzubereiten, dass sie in unterschiedliche Rechts- und Förderkontexte übertragbar werden.
Was Deutschland daraus mitnehmen kann
- Förderung messbar machen
Jede Prüfung – Jahresabschluss, Geschäftsmodellanalyse oder Sonderprüfung – braucht ein Wirkungsmodul:- Wie profitiert welches Mitglied konkret?
- Wie werden Nichtmitglieder behandelt?
- Wird der Förderzweck oder die Kapitalrendite priorisiert?
- Hürden gezielt abbauen, statt pauschal „entbürokratisieren“
Digitale Verfahren (Textform/eID), modulare Prüfung und klare Fristen beschleunigen, ohne Schutzniveaus zu senken. Die Pflichtprüfung bleibt Gläubiger- und Mitgliederschutz – aber mit klarem Fokus auf Förderzweck, nicht auf formaler Überdokumentation. - Energy Sharing wirklich ermöglichen
Ein eigenständiger, praxistauglicher Rechtsrahmen mit nachvollziehbarer Netzentgeltlogik und einfacher Bilanzierung macht lokale Energie bezahlbar und wirtschaftlich tragfähig – idealerweise mit Genossenschaften als Trägerinnen von Bürger:innenenergie. - Workers-Buy-outs als Option systematisch entwickeln
Bei Strukturbrüchen in Industrie und Mittelstand sollten Mitarbeiter:innen-Genossenschaften nicht die exotische Ausnahme, sondern eine reguläre Option sein – mit rechtlich und finanziell hinterlegten Förderinstrumenten. - Bildung und Nachwuchs verankern
Studentengenossenschaften und Bürger:innen-Genossenschaften können zu „Testeinrichtungen“ für demokratische Governance, ökosoziale Geschäftsmodelle und digitale Genossenschaftsverwaltung werden – wenn Hochschulen, Kommunen und Verbände sie aktiv unterstützen.
Ein wichtiger Gedankenanstoß – die Digitalisierung ersetzt keine Demokratie.
Südtirol zeigt, wie digitale Verwaltung und eine straffe, auf den Förderzweck ausgerichtete Förderprüfung Tempo bringen können. Aber die stärkste Technologie bleibt die Mitgliederkontrolle: Wer Förderung verspricht, muss zeigen, wie – verständlich, messbar, überprüfbar.
Wenn Deutschland diese Logik mit einem praxistauglichen Rechtsrahmen für Energy Sharing, einer konsequent förderorientierten Pflichtprüfung und digitalen, transparenten Governance-Strukturen verbindet, kann die Genossenschaft wieder das werden, was sie in früheren Krisen war: ein robustes Instrument für Erneuerung – von unten nach oben.
Autor: Dr. Kuhn für CoopGo



