14.Juli 2025. Genossenschaften unterscheiden sich von anderen Rechtsformen durch Gemeinschaftseigentum, Teilhabe, Transparenz und Mitbestimmung. Im deutschen Genossenschaftsgesetz von 1869 wird im § 1 der genossenschaftliche Förderauftrag hervorgehoben.
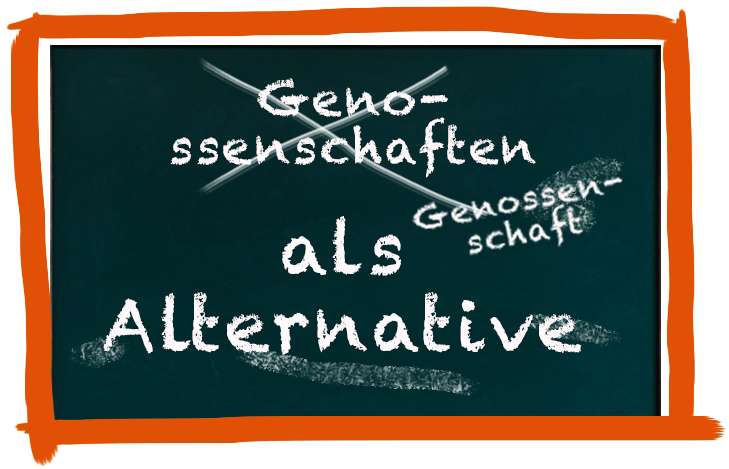
Im Rahmen unserer internationalen Berichterstattung: Coops the best-kept Secret Genonachrichten analysieren die GenoNachrichten die Geno-Ratio in unterschiedlichen Ländern und Regionen. Zu den deutschen Besonderheiten zählt der genossenschaftlichen Förderauftrag, denn der in § 1 des Genossenschaftsgesetz beschriebene, Auftrag zur Mitgliederförderung. Hinzu kommen die genossenschaftlichen Prüfungsverbände die mit einem Prüfungsmonopol ausgestattet sind und seit 1889 den gesetzlichen Auftrag haben die ordnungsgemäße Geschäftsführung zu überwachen und zu testieren. Genossenschaften sind Gemeinschaftsunternehmen die sich im Eigentum ihrer Mitglieder befinden. Aus diesem Grund steht Mitgliederförderung immer vor Gewinnmaximierung. Nur so lässt es sich begründen, dass die Genossenschaftsmitglieder nicht am Wertzuwachs ihrer Genossenschaft beteiligt werden. Denn die Genossenschaft soll kein Vermögen aufhäufen, sondern ihre Mitglieder fördern. In diesem Zusammenhang ist die vom Gesetzgeber in der Bundestagsdrucksache V/3500 getroffene Aussage interessant. Diese, laut Satzung zwingend vorgeschriebene wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder „hat sich im Wege unmittelbar gewährter Sach- und Dienstleistungen zu vollziehen, so daß sich für die Genossenschaften die Gewinnmaximierung als tragende Zielvorstellung der Geschäftspolitik verbietet. Damit unterscheiden sich die Kreditgenossenschaften grundsätzlich von den übrigen privatrechtlichen Kreditinstituten. Diese Aussage bezieht sich auf die Kreditgenossenschaften, die von der Mitgliederanzahl stärkste Genossenschaftsart. Grundsätzlich treffen diese Aussagen aber auch für Einkaufs- Energie- oder Wohnungsgenossenschaften zu.
Auch das Bundesverfassungsgericht hat diesen Sachverhalt im Jahr 2001 noch einmal bekräftigt: Die Gesellschaftsform der eingetragenen Genossenschaft zeichnet sich durch eine besondere Zielsetzung aus, nämlich die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder (§ 1 Abs. 1 GenG). Zwar werden die Genossenschaften inzwischen in nicht unerheblichem Umfang am freien Markt tätig; die Grundorientierung am Förderzweck unterscheidet sie aber weiterhin von vergleichbaren Kapitalgesellschaften. (Bundesverfassungsgericht, I BvR 1759/91 vom 19.01.2001, RdNr. 34)
Der Bundesfinanzhof sieht dies ebenso und beschreibt sogar die Umsetzung des Förderauftrags. „Die genossenschaftliche Rückvergütung ist eine spezielle, gesetzlich nicht ausdrücklich geregelte Form der genossenschaftlichen Überschussverteilung, die sich auf verschiedene Geschäftssparten (Bezugs-, Absatz-, Leistungs- oder Kreditgeschäfte) beziehen kann (vgl. z. B. Lang/Weidmüller/Metz/Schaffland in Genossenschaftsgesetz, Kommentar, 33. Aufl. 1997, § 19 Rz. 42). Sie richtet sich – anders als die Verteilung des Reingewinnes – nicht nach der Anzahl der von dem Mitglied gezeichneten Geschäftsanteile oder nach der Höhe der Einzahlungen darauf und ist keine Form der Gewinnverteilung (vgl. z. B. Müller, Genossenschaftsgesetz, Kommentar, § 19 Rz. 20; Lang/ Weidmüller/Metz/Schaffland, a.a.O, § 19 Rz. 20).“BFH-Urteil vom 6.6.2002 (V R 59/00)
Seit dem 22.Juli 2017 sind die Prüfungsverbände auch verpflichtet, im Prüfungsbericht dazu Stellung zu nehmen, ob und auf welche Weise die Genossenschaft einen zulässigen Förderzweck verfolgt hat.
Die Pflicht des Prüfungsverbands im neuen § 58 Absatz 1 Satz 3, im Prüfungsbericht zur Einhaltung des Förderzwecks Stellung zu nehmen, dient der Transparenz.
Der Förderzweck stellt das charakteristische Merkmal der Rechtsform der Genossenschaft dar. Vorstand, Aufsichtsrat und die übrigen Genossenschaftsmitglieder sollen frühzeitig gewarnt werden, falls sich eine Genossenschaft von ihrem Förderzweck entfernt. Der Fall, dass eine Genossenschaft keinen oder keinen zulässigen Förderzweck mehr verfolgt, ist zwar in der Praxis äußerst selten, er kann aber sehr gravierende Folgen haben: Gemäß § 81 GenG kann die Genossenschaft aufgelöst werden und wenn eine unzulässige Dividendengenossenschaft vorliegt, könnte ein unerlaubtes Investmentgeschäft vorliegen, gegen das die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin einschreiten kann. Möglicherweise hat auch die BaFin in Sachen Genossenschaftsrecht einen akuten Nachholbedarf.
„Die Besonderheiten der genossenschaftlichen Rechtsform gebieten es, nur mit großer Zurückhaltung Analogien zum Recht der Kapitalgesellschaften, vor allem der Aktiengesellschaft, anzuwenden. Zweifelsfragen, die sich aus den Regelungen des GenG ergeben, sind in erster Linie aus der Rechtsnatur der eG, ihrem gesetzlichen Förderauftrag und den anerkannten genossenschaftlichen Grundsätzen zu klären; nur ausnahmsweise und ergänzend dazu kann eine entsprechende Anwendung vereins- oder aktienrechtlicher Vorschriften in Betracht kommen.“(Lang/Weidmüller, GenG, 39 Auflage, § 1 Rnr 4)



