Brüssel, den 19.November 2025/ Was bedeutet digitale Souveränität – und wer hat sie heute? Warum wir Genossenschaften gerade jetzt – im Schatten von „Chat Control light“ – brauchen. Genossenschaften sind systemisch anders. Genossenschaften sind keine bloße Rechtsform, sondern folgen einer eigene Governance-Logik.
A. Darum sind folgende drei Punkte für die digitale Souveränität entscheidend:
- Eigentum in der Hand der Nutzenden
In einer Genossenschaft gehört die Infrastruktur den Mitgliedern – nicht anonymen Aktionären, nicht einem Staat und nicht einem Venture-Capital-Fonds.
→ Wer die Server bezahlt und besitzt, kann auch darüber entscheiden, ob Backdoors eingebaut oder „freiwillige“ Scans eingeführt werden. - Demokratische Kontrolle statt Konzernlogik
„One Member – One Vote“ verhindert, dass einzelne Großinvestoren oder Regierungsstellen durch Kapitalmehrheit die Richtung bestimmen oder das Unternehmen übernehmen.
Entscheidungen über Verschlüsselung, Standort der Datenhaltung und Kooperation mit Behörden werden zu politischen Entscheidungen der Gemeinschaft, nicht zu geheimen Deals im Aufsichtsrat. - Förderauftrag statt Profitmaximierung
Genossenschaften sind ihrem Förderzweck verpflichtet und dieser Förderzweck wird regelmäßig überprüft. Eine digitale Genossenschaft kann sich etwa in der Satzung verpflichten:
- Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht zu schwächen,
- Daten ausschließlich in bestimmten Rechtsräumen zu verarbeiten,
- keine datengetriebene Verhaltenswerbung zu betreiben.
Damit wird digitale Souveränität Teil des Geschäftsmodells – nicht dessen Kollateralschaden.
Aktuelle Studien definieren digitale Souveränität als Fähigkeit, die eigene digitale Transformation unabhängig zu gestalten – mit Blick auf Hardware, Software, Dienste und Kompetenzen. Es geht darum, selbst entscheiden zu können, in welchem Maß man sich von Anbietern und Partnern abhängig macht.
Die Realität sieht anders:
- Europas Daten liegen in hohem Maße bei US-Konzernen, die zusätzlich dem US CLOUD Act unterliegen.(WIK)
- Immer mehr kritische Dienste (Kommunikation, Cloud, KI) werden von wenigen, global agierenden Plattformen kontrolliert.(Bertelsmann Stiftung)
- Parallel dazu formt die EU mit Projekten wie Gaia-X und „Digital Commons EDIC“ zwar neue Infrastrukturen, aber in der Praxis entscheidet weiter oft das Kapital und nicht die Bürgerschaft.(Gaia-X)
B. Digitale Souveränität ist bislang vor allem: Souveränität von Staaten, Behörden und Großunternehmen.
Die Souveränität der Bürgerinnen und Bürger – und kleinerer Unternehmen – kommt dagegen viel zu kurz.
Die Debatte um die EU-Verordnung zur Prävention und Bekämpfung von sexuellem Kindesmissbrauch („CSA-Verordnung“, im Netz als „Chat Control“ bekannt) zeigt, wie fragil digitale Freiheitsrechte geworden sind. Selbst der jüngste Ratsentwurf, den CEPIS treffend als „Chat Control light“ kritisiert, ist zwar ein Schritt weg von der zwingenden Client-Side-Scanning-Pflicht, hält aber zentrale Hintertüren offen.(CEPIS)
Vor diesem Hintergrund ist die Frage zentral: Wer kontrolliert eigentlich unsere digitale Infrastruktur – und in wessen Interesse?
Genossenschaften bieten hier eine strukturell andere Antwort als Big Tech und staatsnahe Monopole. Sie sind nicht nur ein „nettes“ Alternativmodell, sondern ein strategisches Werkzeug für echte digitale Souveränität.
Die neue CEPIS-Stellungnahme vom 18. November 2025 bringt es auf den Punkt: Der aktuelle Ratsvorschlag nimmt zwar die Pflicht zum flächendeckenden On-Device-Scanning zurück, erweitert aber gleichzeitig den Umfang möglicher Scans und schafft neue Risiken.(CEPIS)
Kernprobleme:
- Ausweitung des Scan-Umfangs
Statt nur Bilder sollen nun auch Text und Video erfasst und sogar neu generiertes Material identifiziert werden. Die dafür nötigen KI-Verfahren sind nach Einschätzung der Fachwelt weit davon entfernt, hinreichend zuverlässig zu sein.(CEPIS)
→ Die Folge wären massenhaft Fehlalarme, überlastete Strafverfolgung und unzählige zu Unrecht Verdächtige. - Zwang zu Altersnachweisen und faktisches Ende anonymer Kommunikation
Vorgesehene Altersverifikationen für App-Stores und verschlüsselte Dienste bedrohen anonyme und pseudonyme Accounts. Damit geraten Whistleblower, Beratungsstellen, Journalistinnen und bedrohte Personen ins Visier.(CEPIS) - „Freiwilliges“ On-Device-Scanning als trojanisches Pferd
Auch wenn das Scannen nicht mehr zwingend wäre: Sobald ein Anbieter „freiwillig“ auf dem Gerät scannt und Meldungen erzeugt, ist echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung faktisch ausgehebelt. Ein Dienst, der Inhalte vor dem Versand durchsucht und Dritte informiert, kann nicht seriös behaupten, Kommunikation sei vertraulich.(CEPIS)
Der Europäische Gerichtshof hat wiederholt klargestellt, dass anlasslose Massenüberwachung privater Kommunikation mit Grundrechten unvereinbar ist.(CEPIS) Trotzdem entsteht mit „Chat Control light“ erneut eine Architektur, in der Überwachung zum „normalen Betriebsmodus“ wird – und Freiheit zur Ausnahme.
C. Genossenschaftliche Cloud- und Hosting-Infrastruktur
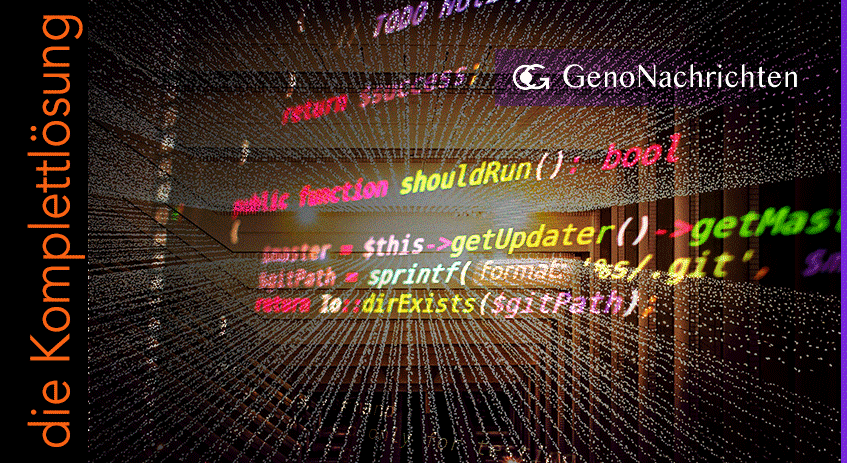
Die Diskussion um „Sovereign Cloud“ zeigt, wie groß das Bedürfnis nach europäischen, rechtssicheren Infrastrukturen ist. Anbieter und Studien betonen:
- vollständige Datenverarbeitung in der EU,
- Unabhängigkeit von US-Gesetzen,
- transparente, auditierbare Open-Source-Stacks.(Telekom Cloud)
Ein konsequent genossenschaftlicher Cloud- oder Plattformanbieter würde noch weiter gehen:
- Mitglieder bestimmen, wo Rechenzentren stehen und welche Software eingesetzt wird;
- die Genossenschaft kann satzungsmäßig ausschließen, an Systemen wie Chat Control (ob verpflichtend oder „light“) mitzuwirken;
- Kommunen, Mittelstand und Zivilgesellschaft können gemeinsam Träger der Infrastruktur sein.
D. Daten- und Plattformgenossenschaften
Die Forschung zu „Data Cooperatives“ und digitalen Commons zeigt, dass kooperative Datenverwaltung ein zentraler Weg zu Datensouveränität ist: Communities verhandeln gemeinsam, zu welchen Zwecken ihre Daten genutzt werden und behalten kollektive Verfügungsrechte.(MDPI)
Vorteile:
- Mitglieder legen gemeinsam fest, welche Daten zu welchen Bedingungen verarbeitet werden.
- Missbrauch und Überwachung wider die Mitgliederinteressen sind strukturell schwerer durchzusetzen.
- Genossenschaften können explizit festschreiben, dass keine Daten für anlasslose Überwachung bereitgestellt werden.
E. Kommunikationsdienste in genossenschaftlicher Trägerschaft
Wenn Messenger, E-Mail-Dienste oder Videokonferenzsysteme genossenschaftlich organisiert sind, entsteht ein direkter Interessengegensatz zu Chat-Control-Ansätzen:
- Ein genossenschaftlicher Provider, der Hintertüren einbaut, betrügt nicht anonyme Kundschaft, sondern seine eigenen Mitglieder.
- Die Genossenschaft kann sich – ähnlich wie die Unterzeichner der aktuellen offenen Briefe gegen Chat Control – politisch klar gegen Client-Side-Scanning positionieren und das in ihren Geschäftsbedingungen verankern.(Nextcloud)
Gleichzeitig können solche Genossenschaften sehr wohl gezielte und rechtsstaatliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Missbrauch unterstützen: besser ausgestattete spezialisierte Strafverfolger, standardisierte Schnittstellen für rechtmäßig angeordnete Auskünfte, Präventionsprogramme – ganz im Sinne der Empfehlungen von CEPIS.(CEPIS)
Genossenschaftliche Perspektive auf „Chat Control light“
Was folgt daraus konkret?
- Backdoors bleiben Backdoors – auch „light“
CEPIS weist zu Recht darauf hin: Sobald auf dem Endgerät gescannt und gemeldet wird, ist echte Vertraulichkeit dahin, ob freiwillig oder verpflichtend.(CEPIS)
Genossenschaftliche Anbieter können hier als Gegenmodell dienen und sich klar verpflichten: keine Mitarbeit an Client-Side-Scanning. - Anonymität als Teil des Förderauftrags
Die vom Rat diskutierten Altersverifikationspflichten bedrohen anonyme Kommunikation.(CEPIS)
Eine digitale Genossenschaft kann dagegen die geschützte anonyme oder pseudonyme Nutzung als Teil ihres Zwecks definieren – gerade im Interesse von Beratung, Journalismus und Opposition. - Institutionalisierter Widerspruch statt symbolischer Protest
Offene Briefe von Unternehmen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft gegen Chat Control sind wichtig.(Patrick Breyer)
Aber genossenschaftliche Strukturen gehen einen Schritt weiter: Sie schaffen dauerhafte Organisationen, die technische Infrastruktur betreiben,
- klare Grundrechtsstandards implementieren,
- und als organisierte Akteure in Brüssel und Berlin auftreten.
Was zu tun ist – Handlungsempfehlungen aus Sicht der Genonachrichten-Leserschaft
- Eigene digitale Genossenschaften gründen bzw. stärken
- E-Mail, Cloud, Backup, Termin- und Projektverwaltung, Videokonferenzen: all das lässt sich genossenschaftlich organisieren.
- Bestehende Rechenzentrums-, Hosting- und IT-Genossenschaften sollten digitale Souveränität ausdrücklich in ihren Satzungen verankern.
- Aus genossenschaftlicher Sicht sollten gegenüber Bundesregierung und EU klargestellt werden:
- Ende-zu-Ende-Verschlüsselung darf weder direkt noch indirekt abgeschwächt werden; Client-Side-Scanning ist auszuschließen.(CEPIS)
- Anonyme und pseudonyme Kommunikation muss – im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH – geschützt bleiben.(CEPIS)
- Genossenschaftliche und gemeinwohlorientierte digitale Infrastrukturen sind gezielt zu fördern, etwa im Rahmen von Digital-Commons-Programmen und Gaia-X-Lighthouse-Projekten.(French Expert in Ireland)
- Eigenes Nutzungsverhalten umstellen Digitale Souveränität beginnt im Alltag:
- Wo es möglich ist, zu europäischen, möglichst genossenschaftlichen oder gemeinwohlorientierten Diensten wechseln.
- Open-Source-Software bevorzugen, deren Entwicklung nicht von Überwachungsgeldern abhängt.(typo3.com)
F: Zusammenfassung:
Die Auseinandersetzung um „Chat Control light“ ist mehr als eine Fachdebatte über eine einzelne Verordnung. Sie steht exemplarisch für die Frage, ob Europa eine digitale Zukunft aufbaut, in der Überwachung schleichend zum Normalfall wird – oder eine, in der Bürgerinnen und Bürger, Kommunen und Mittelstand die digitale Infrastruktur selbst kontrollieren.
Genossenschaften sind dafür kein exotischer Nischenweg, sondern ein weltweit bewährtes, rechtsstaatlich erprobtes Modell: demokratisch, transparent, zweckgebunden und langfristig orientiert.
Wer digitale Souveränität ernst meint, kommt an genossenschaftlichen Lösungen nicht vorbei.



